Trauer ist kein gerader Weg
Wenn du gerade trauerst, hast du bestimmt schon von den „Phasen der Trauer“ gehört. Vielleicht hast du dich gefragt, ob du diese Phasen durchlaufen wirst und in welcher Reihenfolge. Doch hier ist die Wahrheit: Trauer verläuft nicht linear. Es gibt kein Schema F, das deinen Weg durch die Trauer beschreibt.
An einem Tag kannst du lachen und dich leicht fühlen und am nächsten Tag zieht dich der Schmerz wieder mitten hinein. Und das ist völlig normal!
Trauer ist so individuell wie du selbst.
Dennoch bieten Modelle wie die von Elisabeth Kübler-Ross und Verena Kast Orientierung und können helfen, das Chaos der Gefühle besser zu verstehen.
In diesem Blogartikel möchte ich dir die beiden Trauermodelle vorstellen und gerne auch beleuchten, wie ich persönlich sie beurteile und was ich daran kritisch sehe.
Die Trauerphasen nach Elisabeth Kübler-Ross: Ursprung und Kritik
Was beschreiben die Phasen?

Das bekannteste Phasenmodell ist wohl das von Elisabeth Kübler-Ross, einer Psychiaterin, die sterbende Menschen begleitet hat. Ihre Phasen beschreiben ursprünglich den emotionalen Prozess, den Sterbende durchlaufen, wenn sie mit ihrer eigenen Endlichkeit konfrontiert sind.
Die fünf Phasen lauten:
- Verleugnung und Isolation: Der Verlust wird nicht angenommen, der/die Betroffene zieht sich zurück. („Das kann nicht wahr sein.“)
- Wut: Ärger über das Schicksal, über sich selbst, über die verstorbene Person. („Warum passiert das ausgerechnet mir?“)
- Verhandeln: Trauernde versuchen, das Schicksal durch besonderes Verhalten gnädig zu stimmen, den Verlust ungeschehen zu machen.
(„Wenn ich dies oder das tue, wird alles wieder gut.“) - Depression: Verlust des Interesses, der Motivation, der Gefühle.
(„Alles ist sinnlos.“) - Akzeptanz: Das Geschehene wird akzeptiert und die Trauer abgeschlossen. („Es ist, wie es ist.“)
Meine Erfahrung zu dem Modell
Diese Phasen sind wertvoll, um zu verstehen, wie Menschen auf große Verluste reagieren können. Sie bieten Trauernden Orientierung und helfen ihnen, ihre eigene Trauer besser zu verstehen und zu (be)greifen.
Wo liegt die Kritik?
- Nicht für Hinterbliebene entwickelt: Das Modell ist aus Gesprächen mit Sterbenden entstanden und beschreibt deren Abschiedsprozess. Es ist ein Unterschied, ob man seinen nahenden Tod betrauert oder den Tod eines nahestehenden Menschen sowie das eigene Weiterleben.
- Linearität suggeriert: Es scheint, als würde jeder Mensch diese Phasen in genau dieser Reihenfolge durchlaufen. Das entspricht jedoch nicht der Realität. Trauer ist Individuell und chaotisch. Nicht strukturiert und linear.
- Nicht universell anwendbar: Nicht jeder erlebt jede Phasen. Manche Menschen empfinden andere Gefühle, die nicht ins Modell passen. Zudem ist die Art des Verlusts sehr ausschlaggebend dafür, wie Trauer erlebt wird.
Die Phasen der Trauer nach Verena Kast: Ein Modell für Hinterbliebene
Verena Kast hat aus dem Modell von Elisabeth Kübler-Ross vier Phasen abgeleitet und diese Trauerphasen speziell für Menschen entwickelt, die einen Verlust erlebt haben.
Sie beschreibt diese vier Phasen, die Trauernde durchlaufen können:
- Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens: Der Verlust erscheint unfassbar. Viele erleben Gefühle wie Erstarrung oder Schock.
- Phase der aufbrechenden Emotionen: Wut, Schuldgefühle, Angst und tiefer Schmerz treten auf.
- Phase des Suchens und Sich-Trennens: Die trauernde Person sucht nach Erinnerungen und Verbindung zum Verstorbenen, beginnt aber gleichzeitig, loszulassen.
- Phase der Wiederherstellung und Genesung: Trauernde finden langsam wieder in ihren Alltag und entdecken neue Perspektiven.
Stärken und Schwächen des Modells
- Stärken: Kast’s Modell bietet konkrete Anknüpfungen für Hinterbliebene und betont die Wichtigkeit des Suchens und Erinnerns.
- Schwächen: Auch hier wird die Gefahr gesehen, Trauer als linearen Prozess zu verstehen.
Die Aufgaben der Trauer nach William Worden
William Worden, ein renommierter Trauerforscher, hat das Phasenmodell in eine Zustandsbeschreibung umgeschrieben. Statt von Phasen spricht er von vier „Aufgaben der Trauer“, die uns helfen sollen, einen Verlust zu bewältigen. Seine Perspektive ist besonders hilfreich, da sie aktive Schritte betont, die Trauernde unternehmen können:
- Den Verlust als Realität akzeptieren: Der Tod eines geliebten Menschen trifft uns oft unvorbereitet und selbst bei absehbaren Todesfällen ist es normal, den Verlust zunächst zu leugnen. Viele hoffen insgeheim auf eine Rückkehr des Verstorbenen oder empfinden den Verlust wie einen Traum. Doch für die Verarbeitung der Trauer ist es wichtig, den Tod schrittweise zu akzeptieren. Ein Abschied am toten Körper kann helfen, den Verlust begreifbar zu machen. Wenn das nicht möglich ist, können Rituale wie Tagebuchschreiben, Briefe an den Verstorbenen oder das Gedenken an besonderen Tagen unterstützen. Diese Akzeptanz bedeutet nicht, den Verlust gutzuheißen, sondern sich der Tatsache zu stellen, dass die geliebte Person nicht zurückkehrt.
- Den Schmerz der Trauer durchleben und verarbeiten: Der Verlust eines geliebten Menschen löst viele verschiedene Gefühle aus, wie Wut, Angst, Sehnsucht, Schuld oder Einsamkeit. Diese Emotionen können sich auch körperlich äußern, etwa durch Schmerzen oder Schlafprobleme. Solche Reaktionen sind normal und individuell unterschiedlich. Wichtig ist, den Schmerz anzuerkennen und zu durchleben, auch wenn Ablenkung zwischendurch erlaubt ist.
- Sich an die Welt ohne den Verstorbenen anpassen: Anfangs wird oft nicht erkannt, wie viele Rollen der Verstorbene im Leben eingenommen hat, sei es als Partner, Freund oder Unterstützer. Mit der Zeit wird deutlich, welche Aufgaben nun allein bewältigt werden müssen, was oft zu Überforderung führt. Neue Fähigkeiten wie Kochen, Buchführung oder handwerkliche Tätigkeiten müssen erlernt werden. Dies ist anstrengend, eröffnet aber auch Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung. Das Meistern dieser Herausforderungen stärkt das Selbstbewusstsein und hilft, die eigene Identität unabhängig von der verstorbenen Person neu zu definieren.
- Eine Verbindung zum Verstorbenen finden, die es erlaubt weiterzuleben: Dabei geht es darum, die Erinnerungen an den Verstorbenen zu bewahren und sie in den Alltag zu integrieren, ohne sich daran zu binden. Diese Verbindung kann auf viele Arten gestaltet werden, etwa durch Fotos, Gedenkorte wie einen Friedhof oder persönliche Rituale. Manche tragen Schmuck oder Tattoos zur Erinnerung, andere finden Trost an Orten, die sie gemeinsam besucht haben. Es ist wichtig, einen positiven Platz für den Verstorbenen zu schaffen, der nicht von Ängsten oder Zwängen überschattet wird. Dadurch wird es möglich, die Erinnerungen liebevoll zu bewahren und gleichzeitig selbst weiterzuleben.
Chris Paul, die sich ebenfalls seit vielen Jahren als Expertin in Sachen Trauer etabliert hat, hat Worden’s Aufgaben um eine weitere ergänzt:
- 5. Die Trauer rekonstruieren: Dem Leben (wieder) einen Sinn geben und zu reflektieren, was die Trauer einen gelehrt hat. „Was hat die Krise mir gezeigt? Was habe ich daraus gemacht? Was ist daraus entstanden?“
Ich persönlich finde diesen Zusatz von Chris Paul sehr wertvoll. Denn Resilienz entwickeln wir aus Erfahrungen. Jede Krise bringt immer auch etwas Positives mit. Auch wenn wir das erst sehr viel später im Leben erkennen.
Was mir am Ansatz von William Worden gefällt
Wordens Ansatz ist dynamisch und flexibel. Anstatt einen starren Prozess vorzugeben, betont er die individuelle Gestaltung der Trauerarbeit. Das Modell ermutigt Trauernde, aktiv Schritte zu unternehmen und nimmt gleichzeitig den Druck, einen festgelegten Ablauf einzuhalten. Es zeigt, dass Trauer ein Prozess ist, bei dem es nicht nur um das „Loslassen“ geht, sondern auch um das Bewahren und Weiterentwickeln.
Wo begegnen uns solche Phasen der Trauer im Alltag?
Die Phasen der Trauer sind nicht nur auf den Verlust eines geliebten Menschen anwendbar. Sie tauchen bei jeder großen Veränderung auf und sind heute aus keinem Buch über Changemanagement mehr wegzudenken. Sie helfen dabei, emotionale Reaktionen auf Veränderungen zu verstehen und zu begleiten.
Große Veränderungen bringen oft ähnliche emotionale Prozesse mit sich wie Trauer. Das liegt daran, dass jede Veränderung, ob freiwillig oder erzwungen, einen Abschied von Gewohntem bedeutet. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Anpassung an Neues kostet Energie.
Wenn wir uns von einer alten Rolle, einem vertrauten Umfeld oder einer bekannten Aufgabe verabschieden müssen, durchlaufen wir oft diese emotionalen Phasen. Es ist ein innerer Prozess, der uns dabei hilft, mit dem Verlust des Alten zurechtzukommen und Platz für das Neue zu schaffen.
Wie können wir solche Phasen schneller durchlaufen?

Der Schlüssel liegt in der bewussten Auseinandersetzung mit der Veränderung. Indem wir die Phasen erkennen und annehmen, können wir aktiv an unserer Anpassung arbeiten:
- Akzeptanz üben: Sich einzugestehen, dass Veränderungen zum Leben gehören, hilft, den Widerstand zu verringern.
- Emotionen zulassen: Wut oder Traurigkeit sind normale Reaktionen und sollten nicht unterdrückt werden. Was löst diese Emotionen in dir aus? Ist es Angst, Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht, Trotz?
- Positive Aspekte suchen: Jede Veränderung bietet Chancen. Überlege, was du durch den neuen Abschnitt gewinnen kannst. Was lernst du aus der Veränderung?
- Unterstützung annehmen: Sprich mit anderen, die ähnliche Veränderungen erlebt haben, oder suche professionelle Begleitung, wenn du merkst, dass du alleine keinen Weg aus der Negativspirale findest.
Beispiel: Wechsel im Beruf
Stell dir vor, du wirst nach zehn Jahren in eine neue Abteilung versetzt. Zuerst leugnest du die Veränderung („Das passiert nicht wirklich.“). Dann spürst du Wut („Warum werde ich hier rausgerissen?“). Vielleicht versuchst du zu verhandeln („Ich bleibe, wenn ich diese neue Aufgabe übernehme.“). Irgendwann kommt die Traurigkeit („Ich will meine Kollegen nicht verlassen.“) und schließlich die Akzeptanz („Okay, ich versuche es. Vielleicht ist es ja ganz interessant.“).
Veränderungen, selbst positive, können Trauerprozesse in Gang setzen. Doch mit Zeit und bewusster Reflexion kannst du lernen, diese Phasen schneller zu durchlaufen und gestärkt daraus hervorzugehen.
Fazit: Trauer ist individuell – Dein Weg zählt
Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Artikel ist, dass Trauer so individuell ist wie du selbst. Es gibt keine feste Reihenfolge, keine richtige oder falsche Art zu trauern. Jeder Mensch durchläuft seine Trauer auf eigene Weise und in seinem eigenen Tempo.
Die verschiedenen Modelle von Kübler-Ross, Kast und Worden geben Orientierung, um die eigene Trauer besser zu verstehen. Doch Trauer verläuft nicht linear und hält sich nicht an festgelegte Phasen. Du kannst dich heute auf einem guten Weg fühlen und morgen in frühere Gefühlszustände zurückfallen – das ist völlig normal.
Darüber hinaus habe ich dir gezeigt, dass Trauer nicht nur den Verlust eines geliebten Menschen betrifft, sondern auch in vielen anderen Lebensveränderungen vorkommt. Diese Phasen oder Aufgaben können uns helfen, mit Veränderungen im Alltag besser umzugehen.
Trauer bedeutet, sich auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu dir selbst, deinen Gefühlen und einem Leben, das trotz des Verlusts neue Perspektiven bietet.
Gemeinsam durch die Trauer

Wenn du das Gefühl hast, in deiner Trauer stecken zu bleiben, oder dir wünschst, besser mit den Phasen umgehen zu können, bin ich für dich da.
In meinem Trauercoaching finden wir gemeinsam heraus, was du brauchst, um wieder Kraft zu schöpfen. Egal, ob du dich gerade mitten im Sturm der Emotionen befindest oder nach einem Weg suchst, den Verlust in dein Leben zu integrieren.
Auf meiner Homepage www.gefuehlskarussell.com erfährst du mehr über mich und mein Angebot. Hier kannst du dir auch direkt ein kostenloses Erstgespräch buchen. Gemeinsam gehen wir deinen Weg durch die Trauer.
Ich schaffe einen Raum, in dem du gehalten wirst!

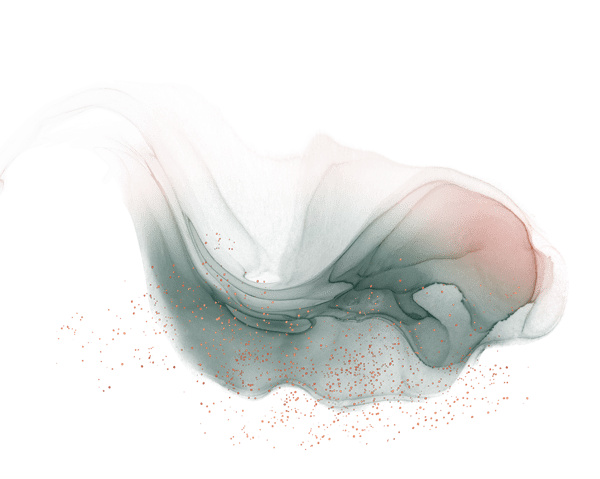








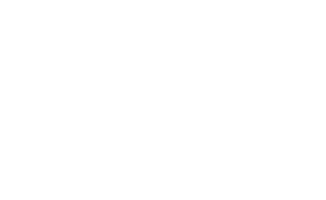
Schreibe einen Kommentar